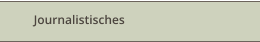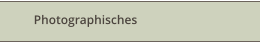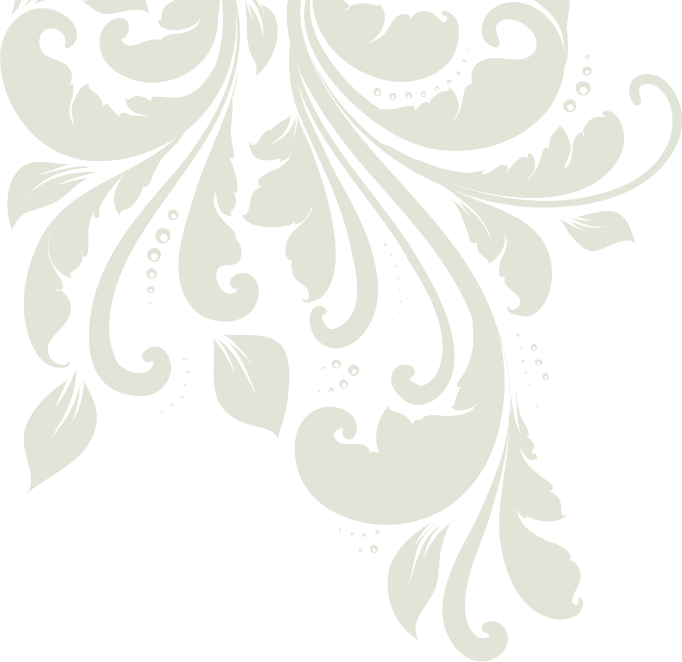


SANTIAGO

© Barbara Henrike Schuhrk 2018









Praia ...
Erste Stressgefühle schiebe ich auf die Flughafen-Stimmung. Ich wusste ja, dass Praia keine Idylle
ist.
Scharen von Taxifahrern stürzen sich auf mich, als ich das Gebäude verlasse.
Brav hatte ich zuvor nachgesehen, wie die Strasse heisst, wo ich hin möchte ... Und so wirke ich
nicht so dumm, wie ich mich fühle.
Mit dem Taxi geht es zur TACV mitten auf dem Plateau. Fast erleichtert sinke ich dort in den Stuhl.
Ein Flug nach Fogo, habe ich beschlossen, soll noch sein.
Ich blicke aus dem Fenster und sehe die Menschen eilen, bin froh, eine Tür hinter mir geschlossen
zu haben. Allein die Fahrt hier hin mutet an wie ein Wettlauf, Menschenmassen überall, plötzlicher
Autoverkehr, im Gegensatz zu Boavista, wo man stundenlang auf den Strassen verharren könnte,
ohne auch nur einmal zur Seite gehen zu müssen. Ein Treiben, ganz anders, als ich es bisher erfuhr.
Ich verlasse die Agentur und gehe zielstrebig die Strasse hinunter, zu Fuss zum Markt, Sucupira.
Die Bürgersteige sind eng und überfüllt, Menschen eilen ohne Rücksicht, bleiben stehen, rasen
weiter, hier ein Stand, wo diverse Waren feilgeboten werden, dort ein Mensch, der mit Blicken
beobachtet, dass ich es als unangenehm empfinde. Ich fühle manche Blicke im Nacken und auf
meinem Gepäck, auf meinem Gesicht und in meiner Seele.
Erstmals trage ich Maske und bekomme das Gefühl „Every smile takes money ...“
Jedes Lächeln kostet, jede Frage.
Und ich werde es noch viel deutlicher erfahren.
Desilusao – fällt mir ein, ich fühle mich beklemmt, unsicher, doch ich versuche es nicht zu zeigen.
Es herrscht eine Atmosphäre, dass das Misstrauen wächst.
Praia, Sucupira, Assomada ... bleibende Erinnerungen voller Unwirklichkeit und prallster
schmerzender Realität.
Kaum unten angekommen besticht der
Markt durch Lebhaftigkeit, Farben,
pralles Miteinander, Afrika.
Einen Moment lang betrachte ich die
Szenerie. Eine Frau kippt das dritte
Mal abgestandenes Wasser über einen
Frisch-Fisch, der in der Sonne brät.
Andere wedeln die Fliegen weg.
Obststände, Fisch, Fleisch, Bohnen
und Gewürze, Kleidung und alles, was
man zum Leben brauchen könnte oder
eben nicht.
Der Bruch nur Sekunden später: Die
Aluguer-Fahrer.
Wie Geier stürzen sie sich auf Touristen, buhlen um ihren Mitfahrwunsch, übertönen sich,
drängeln, drängen sich auf.
Die Hintergründe, dass diese Fahrer ein Aluguer zu mieten haben, jeder Fahrgast ein Teil des
Überlebenskampfes ist, sind klar. Aber rechtfertigt es die entwürdigende Art, wie auch
einheimische Frauen ins Aluguer genötigt werden?
Zwei, drei Burschen springen heraus, packen die Frauen am Arm, ein zunächst buntes Treiben, was
anmutet wie ein vermeintlicher Überfall ...
„Assomada?“ fragen sie.
Die junge Frau verneint.
Zu zweit reden sie auf sie ein, schieben sie in Richtung Auto.
Also doch Assomada ...
Ich beobachte. Nach eineinhalbstündigen Runden durch Praia ist der Wagen endlich voll.
Ich sitze still in meiner Ecke, schaue, freue mich, nicht mehr die einzige Frau im Auto zu sein.
Später bin ich die einzige, die raus will.
Ich brauche eine Toilette.
Bei der ersten Ansammlung von mehr als fünf Häusern steige ich aus. Pikos heisst der Ort.
Kein Gebüsch, keine Nische – aber ein freundlich lächelnder Schwarzer am Wegesrand. Ein
Schuhputzer, er heisst Joseph.
Nachdem er mein Ansinnen verstanden hat, möchte er mir helfen.
Er fragt in mehreren Häusern nach, bis ich so nervös bin, dass wir in der Mission landen, einem
kleinen Krankenhaus. Während ich zunächst an den Menschen vorbeistürme, der Doktor mich
beruhigt, meinen Puls fühlt, bis er versteht, dass ich nur seine Toilette benötige, sehe ich mich
anschliessend um.
Es kostet hier viel Zeit, zum Arzt zu gehen. Und jene, die hier sitzen, brauchen ihn dringend.
Josef und ich gehen bis zur Hauptstrasse, wo ich ausstieg.
Wir reichen uns die Hände und er bittet mich, Pikos nicht zu vergessen. Ich bin besänftigt.
Bis Assomada ...
Mein Aluguerfahrer erklärt, er fahre nicht nach Tarrafal, ich müsse umsteigen.
Er bringt mich zu seinem Kollegen und ich bekomme das Gefühl, dass neben der Fahrerei die
Haupteinnahmequelle ist, Touristen für dumm zu verkaufen ...
Der Kollege fährt nach Tarrafal und ich steige ein. Doch der Geldbetrag, den der Mann verlangt
wächst minütlich, nun soll auch der Rucksack als Person gelten.
Meine Gegenerklärung stört ihn nicht. Er diskutiert. Vehement. Und ich beschliesse auszusteigen.
Als mir das verwehrt wird, er mir mit seinem Arm den Weg versperrt, sich vor mir aufbaut, bin ich
das erste mal wütend.
Meine Augen scheinen es ihm deutlichst zu erklären, rasch nimmt er den Arm beiseite – nicht
jedoch, ohne mir zu folgen, nicht ohne dass ich von drei weiteren Kollegen verfolgt werde, die
mich nun alle nach Tarrafal bringen möchten, dies lautstark betonen und auch nach drei
Strassenzügen noch auf mich einreden.
Bisher hatte ich das Gefühl, als Frau könne man hier problemlos allein reisen.
Nun stelle ich fest, dass man das nur sollte, wenn man im Zweifelsfall auch energisch auftreten
kann ...
Ich ignoriere den Club der Fahrer, ziehe meine Maske tiefer und bestelle mir in der prallen
Mittagssonne am nächsten Stand ein Sagres.
Und ich beschliesse zu wandern!
Männer, die ich nun nach dem Weg nach Tarrafal frage, wollen mich zu den Aluguers begleiten, ich
lehne dankend ab. Der junge Schuhputzer möchte Geld dafür, mich zu denen zu bringen, denen ich
eben entwich.
Nocheinmal mehr an den grinsenden Fahrern vorbei möchte ich nicht.
Frauen zeigen mir nach dem fünftenVersuch den Weg. Sie wirken noch vertrauensvoller in diesem
Moloch der Wegelagerer.
Ich wandere! Zeit zu denken, der Schweiss rinnt, die Wut legt sich.
Der Fussweg nach Tarrafal lässt hoffen. Lächelnde Menschen, die mich weder fahren möchten,
noch mir etwas verkaufen wollen oder mich anbetteln.
Ein kleiner Junge fragt mich entgeistert, wohin ich gehe.
Touristen fahren Auto und gehen nicht zu Fuss. Schon gar nicht ins über 20 Kilometer entfernte
Tarrafal. Ich sehe ihm an, dass er mich für verrückt hält. Aber er ist freundlich zu mir und will
nichts von mir.
In den Dörfern begegnen mir wieder offene Menschen.
Der Architekt, der gerade ein Haus baut, in Frankreich gearbeitet hat: Nun ist er wieder arm, aber
daheim. Ohne Sodade ... Die Kinder, die mich anstrahlen und die Frauen, die stolz sind, dass ich
ihre Kinder bewundere.
Nach einigen Bergen und Tälern in sengender Hitze und rund 10 Kilometern, wie ich später mit
dem Auto feststellen werde, ist mir endgültig warm. Ich geniesse die Unterhaltung.
Und ich gebe nach. Ein Aluguer hält. Ich fahre nur noch in offenen Aluguers, wo ich abspringen
kann, denke ich noch.
Irrtum.
Abspringen wäre Wahnsinn.
Das erste Mal in Cabo Verde habe ich Angst.
Der Fahrer übt für den Grand Prix, rasant legt er sich mit dem Wagen in Kurven, wo neben mir nur
noch der Abgrund wartet.
Ich höre auf, die knochigen Hühner zu zählen, die aufgeregt zur Seite flattern, blicke lieber nach
hinten, um nicht zu sehen, wie nah wir gerade am Selbstmord vorbei gerast sind.
Die beiden Männer die durch lautstarkes Pfeifen auf sich aufmerksam machten, um mitgenommen
zu werden, steigen nach Vollbremsung ein. Sie reden ein bisschen, lächeln, halten sich fest und
sind freundlich.
Innerhalb kürzester Zeit rasen wir in den Ort: Tarrafal.
Ein Markt. Fast zitternd stecke ich mir eine Zigarette an und erinnere mich daran, atmen zu
müssen. Mit meinem Rucksack und dem Touristenstempel auf der Stirn fühle ich mich zum Opfer
berufen und deplaziert.
Wieder ein buntes Treiben, hübsch anzusehen. Ich muss mitten durch, fühle mich mit Gepäck nicht
zum Verweilen angeregt, aber empfinde es hier schon gemächlicher als noch eben in Assomada.
Ich lande in meinem Zimmer, Pension Sol Marina. Hundekot auf den Betten, Bauarbeiten, Lage mit
Blick auf Müllhalde und Unrat hinter dem Haus, dahinter irgendwo das Meer.
Zwar hatte ich weder europäischen Komfort erwartet noch erhofft, aber ich fühle mich nicht wohl
- und gehe wieder.
Der Weg von Boavista nach Santiago ist weit. Wie eine Dunstglocke legt sich eine seltsame
Atmosphäre über die Insel, ein Dunst von Beklemmung, Armut, Schmutz, Berechnung, Elend und
der Gratwanderung.
Unerfüllte Hoffnungen und letzte Träume liegen dicht bei einander.
Was auf Boavista arm war, war dennoch von Sauberkeit und Würde und Freundlichkeit.
Die Menschen hier wirken edel, stolz anmutend, in der Bewegung.
Doch wirklichen Stolz fand man auf Boavista. Hier ist viel verloren gegangen, an Würde.
Was man auf Boavista manchmal vermutete, ist hier offensichtlich, was dort im Verborgenen
bleibt, holt mich hier ein.
Die Städte scheinen jenen anzuziehen, der es auf dem Land nicht packt. Endstation, durch
Tourismus und krasse Gegensätze zwischen arm und reich noch schlimmer ...
Drei Jungs zwischen vier und sechs lächeln mich auffordernd an, fordern dann Entlohnung für die
Frage nach dem Weg, den sie mir als Eskorte zeigen ...
Ich lande im Baia Verde, unter Palmen – den einzigen Strand-Palmen von Cabo Verde, direkt am
Meer. Als ich erneut eine Zimmertür hinter mir schliesse, atme ich durch.
Wo war ich? Mein erster Eindruck - ein Schock.
Ich bin verändert und meine erste Reaktion ist Rückzug.
Wo war die offene Freundlichkeit? Bin nahe den Tränen, zweifele ...
Darf ich noch lächeln, oder kostet es auch? Darf ich noch fragen?
Offenheit wandelt sich in ein vorsichtiges Misstrauen und Traurigkeit.
Boavista empfing mich mit offenen Armen,
Santiago mit fordernden Händen ...
Die Toilette besticht durch eine eigenwillige Brillenpolsterung, saugfähig, komfortabel anmutend,
aber ich klappe sie lieber hoch ...
Das Wasser kommt nur sporadisch und ist kalt. Das alles stört mich nicht, die europäischen
Anforderungen sind fort, störend ist, was in meinem Kopf geschieht...
Ich nehme mir ein Herz und gehe in den Ort. Die Luft gar ist eine andere, der Geruch: Tiere liessen
sich auf Boavista vermuten, doch hier riecht es ohne dass Tiere da sind. Schmutz.
Der Kontrast zur Sauberkeit Boavistas ist allgegenwärtig.
Vor den Häusern dümpeln Essensreste in Kochtöpfen in der Sonne, der Inhalt mehr lebendig denn
tot ...
Der Markt riecht nach Verwesung, eine aufreizende Mischung aus totem Fleisch, Fäkalien und
Unbekanntem, was ich auch nicht näher ergründen möchte.
Und immer wieder die Musik ...
Cesaria Evora, die bekannteste Sängerin der kapverdischen Inseln.
Traurige Morna, voller Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, „sem rume, sem direccao ...“. Lieder über
die Liebe, Stolz und Machtlosigkeit, Sehnsucht und das geliebte Land.
Ein unendlicher Überlebenswillen gepaart mit der Liebe zum Leben, dem Wissen um das Leben.
Der Ruf des Lebens, der sich in der Musik so findet, wie in der Natur und den Menschen...
Überwältigend, Funana, Batuk - und immer wieder der Regen ...
„Se nha terra tinha tschuva, sima nô tem melodia, no ka tava anda na meio d’mundo espalhod”,
was so viel heisst, wie “wenn es in meiner Heimat so viel Regen, wie Melodien gäbe, dann müssten
wir nicht gehen und wären nicht in der halben Welt verstreut …”
Das Lied, was von der Abhängigkeit des Regens erzählt, vom Leben, dass sich nach dem Regen
richtet. Dem Pflanzen nach den ersten Tropfen, dem Eilen auf die Felder, sobald er kommt. Ein
Lied, was von der Emigration singt, von dem Volk, dessen Menschen häufiger im Ausland leben, als
in der Heimat, um dem Hunger zu entfliehen, um Geld zu verdienen, in einem Staat, der ohne
Überweisungen aus dem Ausland noch ganz anders aussähe.
Eine Tour mit dem Wagen trainiert die Gelassenheit weiter.
Nicht wegen der Serpentinen, an die man sich gewöhnt hat, sondern wegen des Motors, der bei
jeder Erhebung dreimal hustet, ausgeht, sich starten lässt, um sich beim nächsten Hubbel auf der
Piste erneut in Krämpfen zu ergehen.
Durch das Innenland Richtung Praia. Serra Malagueta, imposante Berge, bizarr, zerklüftet, so steil,
dass der Blick schon Schwindel hervorruft, bewirtschaftete Terrassen.
Eine Steigung, die in den Nebel führt, so dicht, dass man nur hoffen kann, es möge kein
Gegenverkehr kommen.
Saftig-fruchtbare Täler, Bananenplantagen, Windräder, ungewohnte und ungeahnte Üppigkeit und
Pflanzenpracht.
Die Strasse führt an Picos vorbei. Ich möchte mich nochmals bedanken, suche Joseph.
Suche in der Mission, vor der weithin sichtbaren Kirche.
Keiner kennt ihn und doch weiss jeder, wo er wohnt ...
Es könne nur der Josef aus dem Krankenhaus sein. Ich wundere mich, da es mir so nicht vorkam,
aber wenn er der einzige Josef ist ...
Nein, im Ort wohne er nicht, ich müsse ins Tal ...
Über einen Pfad, der nicht einmal mehr als Piste bezeichnet werden dürfte, führt der Weg in den
Abgrund. Ich bete um jeden Meter, verfluche das Fahrzeug, was sich wie ein schaukelndes Schiff
schneller abwärts begibt, als erhofft.
Zwei, drei Menschen blicken mich an, als ob sie mich für wahnsinnig halten. Aber den Weg
Richtung Joseph, den kennen sie.
Am besagten Haus angekommen, zeigt die lächelnde Frau auf den gegenüberliegenden Gipfel.
Ziele kosten Mühen, denke ich und rede dem Auto gut zu, um dann auf dem gegenüberliegenden
Gipfel auf das Tal verwiesen zu werden – nicht ohne mir diverse Flechtwaren verkaufen zu wollen.
Ich erreiche das Tal und tatsächlich das Haus des Joseph.
Mais auf dem Hausdach, Stroh vor der Mauer, einige hungrige Hühner neben einem unwirklichen
Pfad. Seine zwei kleinen Kinder spielen mit leeren Konservendosen, seine Eltern bitten mich hinein
und seine Frau versucht ihn mit einem nagelneuen Handy im kleinen Krankenhaus zu erreichen, wo
man mir vor drei Stunden sagte, er sei zuhause ...
Nun, dann wolle sie mit mir zu ihm fahren, aber sie müsse sich noch umziehen, erklärt mir die
Gattin freundlich und amüsiert sich während der Fahrt ob unserer Kommunikationsversuche...
Sie sagte mir nicht, dass sie sich im Hause der Mutter umziehen wolle, jener Frau, die mich auf
den gegenüberliegenden Gipfel verwies ...
Während sie sich umzieht, darf ich im Haus der Mutter Platz nehmen und blicke mich vorsichtig
um. Steinfussboden, eine Kommode mit Geschirr und Gläsern, an den Wänden liebevoll
aufgehängte Heiligenbilder und Kreuze, das Schlafzimmer durch einen Vorhang abgetrennt.
Josefs Frau ist umgezogen und ich frage vorsichtig, ob dieser Weg jeden Tag bewältigt werden
müsse ...
Sie bejaht, ich blicke auf ihre Füsse in Plastiklatschen und habe wieder einmal Hochachtung.
Nach einem kurzen Wortwechsel kommt uns die Idee, dass ich die Dinge, die ich Josef geben
wollte, ja auch bei ihr lassen könne ...
Und so lasse ich sie nach einem herzlichen Gespräch und ihrer Einladung, doch einmal zum Essen
vorbei zukommen bei der Mutter zurück und wende waghalsig auf wenigen Metern Piste knapp
neben dem Steilhang, im beruhigten Wissen, meine Verbandsmaterialien, Medikamente und
diverse andere Kleinigkeiten in guten Händen gelassen zu haben.
Als ich nach einer guten Stunde Berg- und Talbahn erneut an Picos vorbeifahre, sehe ich Joseph
noch persönlich...
Er ist Schuhputzer und wohnt in Assomada ...
Und wenn ich ihm danken wolle, so solle ich ihn „rausholen“ aus diesem Leben ...
War es die Naivität, zuvor? Oder einfach die Reaktion auf das, wie man empfangen wird?
Doch wie würden wir reagieren, in Europa??
Zwischen Boavista und Santiago liegt nicht nur das Meer, sondern Welten.
Im Ort reges Treiben.
Hautfarben in jeder dunklen Schattierung, eine Offenbarung aller Völker, die hier ihre Spuren
liessen. Ich konzentriere mich wieder auf das Beobachten.
Andacht in der Kirche. Jugendliche, eben noch aufgeregt schnatternd, betreten mit Kniefall das
Gebäude.Auffallend oft kümmern sich die Väter um ihre Kinder, liebevoll, ja, öffentlich zärtlich.
DER Markt ist weniger hektisch, auch wenn er mir für den Rest der Reise den Appetit auf Fleisch
nimmt. Das was das Meer hergibt wirkt zunehmend wahrhaftig!
Vieles, was hier veräussert wird, hat eine Reise hinter sich, die länger war, als die meinige. Das
Land ist zum Import verdammt. Niemand möchte mich nötigen, mir etwas aufdrängen.
Die Menschen gucken, verkaufen mir Piri-Piri zu einem angemessenen und nicht überteuerten
Preis, auf meine Frage, wo es Musik gibt, beschreibt ein junger Mann mir den Weg – das Angebot
seiner Begleitung lehne ich jedoch vorsichtshalber ab ...
Auf dem Weg begegnet mir Man, der Musiker vom Abend zuvor.
Seinem Freund gehört der Musikladen, ich bekomme einen „Freundschaftspreis“, vermutlich noch
immer höher, als der der Einheimischen, aber geringer, als das, was angeschlagen steht ...
Ich freue mich wie ein Kind ...
Hier im Ort sind die Menschen nicht so offen, wie sie mir noch in Sal-Rei begegneten, aber
freundlicher als in Assomada oder Praia.
Ein Nein wird als ein solches verstanden und akzeptiert.
Begegnungen sind noch immer vorsichtig, doch ich denke darüber nach, was diese Menschen
erfahren haben, von den Europäern ...
Das Konzentrationslager vorm Ort ist gerade mehr als 20 Jahre geschlossen. Die Portugiesen
pferchten hier Freiheitskämpfer, Staatsgegner und alle, die unbequem waren, zusammen.
Ich besuchte es bereits, fühlte mich erinnert an die Filme über das Dritte Reich, die Bilder von
Dachau. In dem Museum auf dem Gelände, untergebracht in einem gelben Baucontainer sind Fotos
ausgestellt, die ernüchtern. Ausgemergelte Gefangene, Helme, Zeitungsausschnitte, heroische
Aufpasser. Und vor der Tür eine Allee von toten Bäumen ...
Am Rande des Ortes Villen von Reichen aus Praia, die Häuser der Entwicklungshelfer. Sie machen
auf elitär, die Gegensätze sind krass und schmerzlich ...
Meine drei kleinen Freunde, gestern noch Wegelagerer in hoffnungsvoller Ausbildung mutieren zu
neugierigen, zwar hartnäckigen, aber doch lieben Jungs.
Sie rufen meinen Namen und schenken mir Muscheln, die „schönsten“ natürlich, von jedem, und
während ich schmunzelnd und beschämt feststelle, dass sie die Touristen einige Meter weiter
anschnorren, verabschieden sie sich von mir mit einem netten „bis morgen“.
Es scheint, als sei ich etwas akzeptierter, als gestern noch. Zumindest aber nicht mehr das
permanente Opfer ...
Ich beginne mein Lächeln wiederzufinden.
Frauen vor den Häusern, Männer im Gespräch. Die Frauen Wasser tragend, in grossen Zubern
waschen sie Kleidungsstücke und Bettwäsche, trocknen sie auf den staubigen Strassen, beschwert
mit Steinen, damit der Wind sie nicht raubt.
Alte Männer und Kinder scheinen offener als die mittlere Generation; Frauen sind zugänglicher,
immer in Bewegung, immer beschäftigt – Santiago wirkt wie eine Insel der Frauen... Afrika scheint
herüber ...
Nach einer kleinen Tour am Sonntag erkenne ich den Strand nicht wieder. Treffen sich dort
allabendlich junge Leute um gemeinsam Ballspielen zu frönen, zu lachen, zu reden
– wieder im Gegensatz zu Boavista, wo nur manchmal am Hauptplatz von Sal-Rei Treffen
stattfanden – so ist nun vor Menschenmassen der Sand kaum zu erkennen.
Musik schallt aus der kleinen Steinbar auf der Felsanhöhe, die Frauen und Kinder tanzen, die
Männer singen und ich kann nicht anders, als inne zu halten.
Weiterhin erfahre ich so etwas wie Freundschaft. Anders als auf Boavista, aber ehrlich.
Luis begegnet mir auf der Strasse.
Er freut sich, stellt mir seinen Freund vor. Dieser unterrichtet die jüngeren Jahrgänge an der
Schule von Tarrafal. Wir reden und beide fragen mich, ob ich mit ihnen ein Bier trinken gehen
wolle. Ich sage zu und Luis stoppt.
Er will nicht auf meine Kosten trinken. Er müsse daher noch nach Hause.
Wir gehen zu ihm, er bittet uns in sein Haus. Ein Flur, ein Wohnraum vollgestopft mit Möbeln,
einfach, aber zum Wohlfühlen.
Zwar widersprechen Kinderwäsche, Spielzeug und Frauenkleider seinen Erzählungen, jedoch stelle
ich keine Fragen mehr ...
Stolz zeigt er mir seine Werkstatt hinter dem kleinen Hof. Er tischlert, Möbel jeglicher Art. Und für
Feiern und Trinken, so erklärt er, mache er noch ein paar Jobs nebenbei.
Wir wandern durch den Ort. In einer Bar bleiben wir hängen, Luis stellt mir einige Freunde vor.
Einer lebt seit Jahren in Paris, macht gerade „Urlaub“ zuhause. Ein anderer will weiterziehen. An
der Theke ein zahnloser Schwarzer, der feucht vor sich hin brüllt. Man geht gelassen mit ihm um.
Auch hier, Respekt und Toleranz.
Plötzlich ein Weisser dazwischen. Er sieht mich an, als sei ich in sein Revier eingedrungen.
Luis begrüsst ihn, sie wechseln wenige Worte. Ich erfahre, er ist Entwicklungshelfer aus den
Niederlanden. Auch wir reden, doch nur kurz. Er betrachtet mich mit kalten Augen, und während
ich in seinem Revier verharre, stellt er sich abseits vor die Tür, um sein Bier zu trinken.
Wir gehen nochmals durch den Ort. Die Nacht wird lang.
Aus der Bude vor der Kirche dröhnt blecherne Musik, die Männer betrinken sich.
Luis schimpft mit dem Lehrer. Er dürfe nicht so viel trinken.
Als Luis zu betrunken ist, um noch zu reden, erzählt der Lehrer.
Seine Frau sei zuhause. Er habe Arbeit, unterrichte die Kleinen in Portugiesisch, er demonstriert
mir den Unterschied zwischen der Sprache der ehemaligen Kolonialherren und Creoul. Doch nach
der Arbeit könne er nur trinken. Er könne bei seiner Frau sein, doch er würde trinken. Er wisse,
dass es nicht gut sei – aber was sonst solle er tun?!
Luis meldet sich wieder zu Wort.
Werde er wiedergeboren, so solle dies in Amerika sein, bei seiner Familie. Sein Bruder, seine
Eltern, alle seien sie in den Staaten. Boston, die heilige Stadt, die Emigranten-Stadt.
Amerika sei gut, Amerika sei ein Paradies und wenn er erst besser Englisch könne, so wäre Amerika
auch sein Paradies.
Darf ich ihm seine Träume rauben?
Es ist spät, der letzte Pontche ist getrunken und ich möchte denken, schlafen und denken.
Luis will mich nicht gehen lassen, wann schon habe er mal jemanden zum reden. Jemanden, der
nicht blau ist und nicht im Teufelskreis steckt ...
Der Lehrer sagt, ich solle gehen, morgen sei auch noch ein Tag und ich solle gehen, wenn ich das
will.
Ich gehe.
Ich bin Santiago etwas näher gekommen. Und traurig.
Am letzten Tag pausiere ich. Keine Wanderungen, keine Erkundigungen, Eindrücke wollen
verarbeitet werden. Ich gehe an den Strand. Die Sonne brennt stärker als auf Boavista, ein sanfter
Wind beruhigt die Haut, das Meer ist traumhaft.
„Meine Jungs“ laufen auf mich zu, schenken mir noch einmal Muscheln und fragen nach Wasser. Ich
bin gerührt. Sie wollten nur Wasser ...
Eine Frau spricht mich an, Französin. Sie habe mich auf Boavista gesehen. Als ihr Mann kommt
reden wir noch einwenig. Sie wollen nach Fogo.
Ich blicke auf das Meer, in die Sonne, auf die Menschen und in den Himmel ...
Mein Lied fällt mir ein ... „Gritos y cantos“...
Aufschrei und Gesang liegen dicht beieinander, auf Santiago.
Mein letzter Abend auf Santiago.
Noch einmal gehe ich durch den Ort, klettere über die Baustelle auf der Hauptstrasse, über die
Baustelle am Platz, verjage dickleibige Kakerlaken, die ich nun fast schon mit Namen kenne.
Der allabendliche muffige Geruch steigt aus den Häusern und legt sich wie eine Decke über die
Stadt.
Ich bin erschöpft.
Noch ein Blick auf die artgeschützten und angeblich potenzsteigernden Schildkröten im viel zu
kleinen Becken, ein letztes Gespräch mit dem Nachtwächter des Baia Verde, der mir auch diesmal
die Fluchthilfe versaut ...
Die Reise zum unbekannten Geliebten.
Ich bin ihm näher gekommen,
beginne mehr zu erfassen,
sehe positives wie negatives.
Ich denke an Boavista,
wo mein Herz sich überschlug,
sehe Santiago,
was diese Liebe auf die erste Probe stellt.
Noch immer bin ich verliebt, doch nicht mehr mit dem Überschwang der ersten Gedanken, nicht
mehr rosarot,
aber vermutlich sehr viel tiefer ...
Gritos y cantos